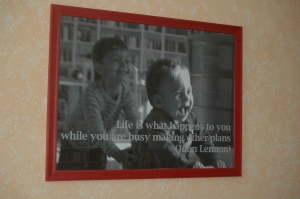Alles gar nicht vergleichbar, sagen viele. Syrer sind doch keine Italiener. Und dies hier nicht die 60er. Nun ja. Sicher sind die Bedingungen heute andere. Es gibt aber trotzdem ein paar Lektionen aus der Geschichte, die man vielleicht berücksichtigen sollte, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, wie Integration heute gelingen kann (also, wenn man denn ein Interesse daran hat, darüber nachzudenken – wenn nicht, ist eh wurscht).
Warnen möchte ich vor allem vor dem leichtfertigen Hantieren mit kulturellen Differenzen. Es gibt eine sehr schöne Studie von Doug Saunders (Mythos Überfremdung – der deutsche Untertitel ist leider blöd), in der er sehr eindrücklich zeigt, wie dieselben Argumentationsmuster immer wieder auftauchen.
Sie lauten etwa: Diese Einwanderer sind ganz anders als die vorherigen. Sie sind zu fremd, zu andersartig, nicht integrierbar. Ihre Loyalität gilt ihrer primitiven, abergläubischen Religion und nicht dem Staat und der Gesellschaft, die sie aufgenommen haben. Und diese Geburtenraten… Sie werden uns alle überrollen, bald stellen sie die Mehrheit.
Das hat man in den 1840er-Jahren über die irischen Einwanderer in England gesagt und erst recht über die osteuropäischen Juden, die zwischen 1870 und 1945 nach Westeuropa und in die USA emigrierten. Das Spiel wiederholte sich, als in den 1950er Jahren die Quote der katholischen Einwanderer (meist Iren und Italiener) in den USA stieg. Heute sagt man das über Muslime.
Es ist wirklich verblüffend, wenn man sich einmal anschaut wie sich die Debatten ähneln (bis hin zu den amerikanischen Feministinnen, die in den Katholiken eine Bedrohung ihrer emanzipatorischen Fortschritte witterten). Die Einwanderergruppen mögen sich unterscheiden, die Reaktion der Mehrheitsgesellschaft nicht.
Die Muslime, die ich im Laufe des vergangenen Jahres kennengelernt habe, wollen nichts anderes als alle anderen Einwanderer vor ihnen: In Ruhe und Frieden ihr Leben leben. Sich einrichten, den Lebensunterhalt verdienen, Kinder großziehen.
Die entscheidende Frage wird also sein, ob die Integration über den Arbeitsmarkt gelingt. Über Industriejobs wie in den 60er und 70er Jahren wird das wohl kaum gehen. Der Dienstleistungs- und Gesundheitssektor hätten in meinen Augen noch erheblich Luft nach oben – aber natürlich haben wir hier das Problem, dass diese Bereiche in den letzten Jahren vor allem durch die Schaffung prekärer Arbeitsverhältnisse geglänzt haben. Fatal wäre es jedenfalls, wenn wir diese Menschen langfristig zu Hilfeempfängern degradieren würden. Dann ginge uns all das verloren, was sie mitbringen: die Energie, die Beharrlichkeit, das Improvisationstalent, das Gespür für Lücken und Nischen, die wir nicht einmal mehr sehen.Und dann wäre die Gefahr tatsächlich groß, dass sie sich nach anderen Quellen umschauen, die ihnen Halt, Identität, Stolz und Anerkennung bieten.
Mein Traum wäre ja, dass es diesen Einwanderern gelingt, die verkrusteten Strukturen ein klein wenig aufzuweichen: den Mangel an Mobilität zwischen verschiedenen Berufen, die Fixierung auf formale Qualifikationen statt einfach mal zu schauen, was einer kann, die endlos langen Ausbildungswege, der Mangel an Mut zum Unternehmertum (und sei es nur Kleinunternehmertum), der bürokratische Rigorismus. Ich wünschte wirklich, sie könnten hier so wirksam werden, wie die anderen Südländer vor ihnen, es in puncto Esskultur, Lockerheit, Lebensgenuß waren. Aber ich bin auch skeptisch. Es wird nicht leicht.